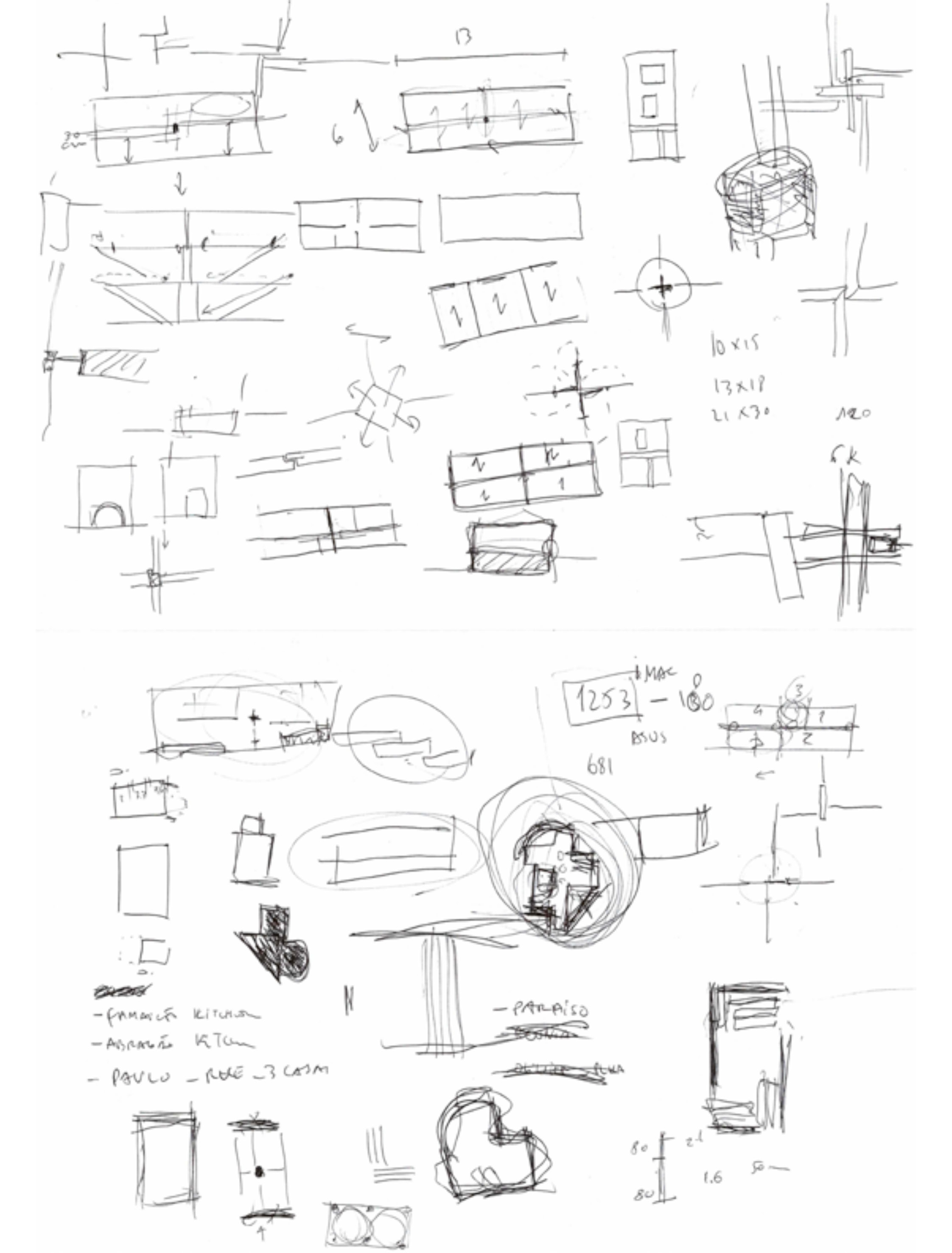150
101

094

102

087

082
185

107

085

067

097
156

114

125
171
143
118

052

068

144

ongoing

077

079
050

a+u
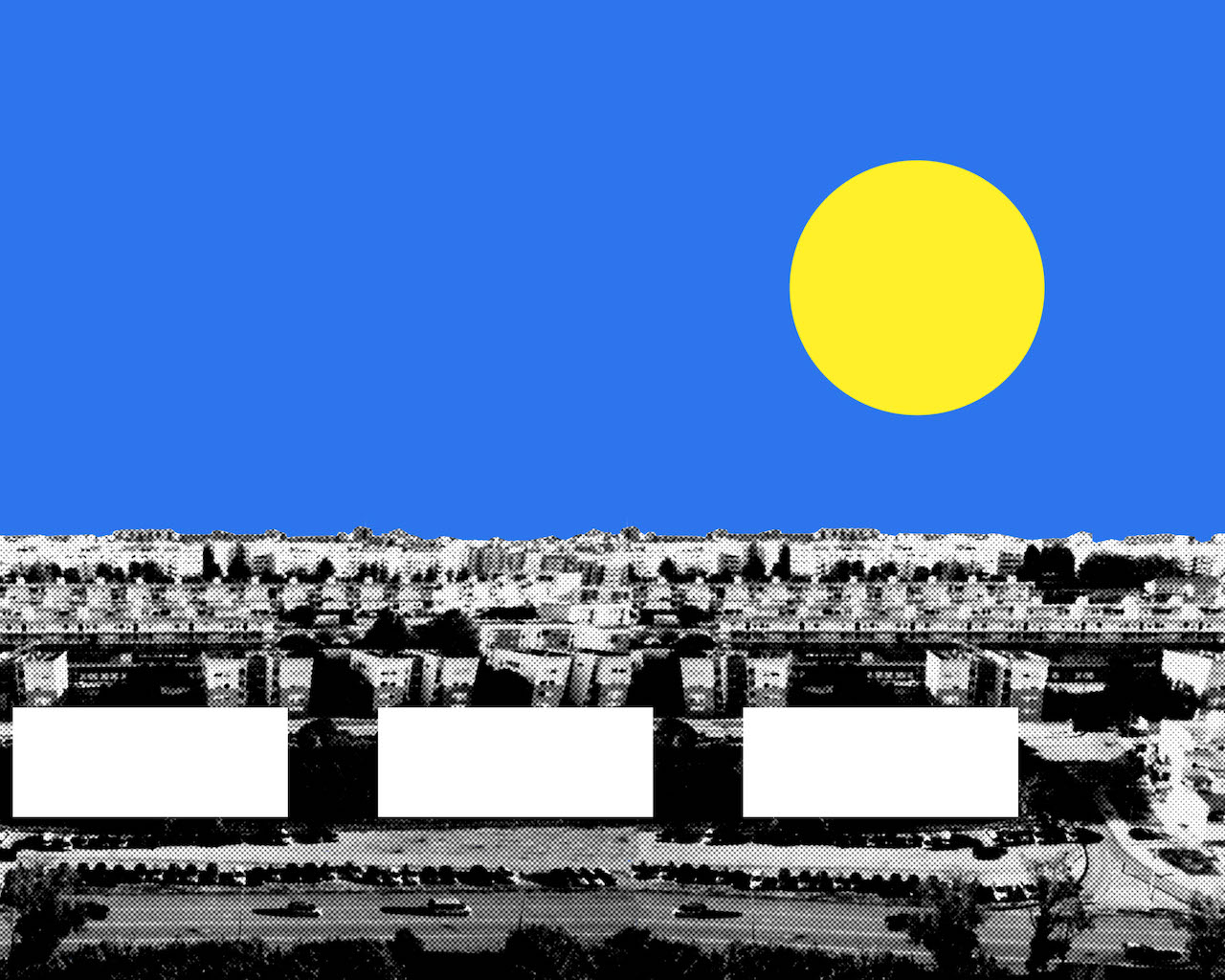
173

048

the usual suspects

farfalle

075

059

098
057

070
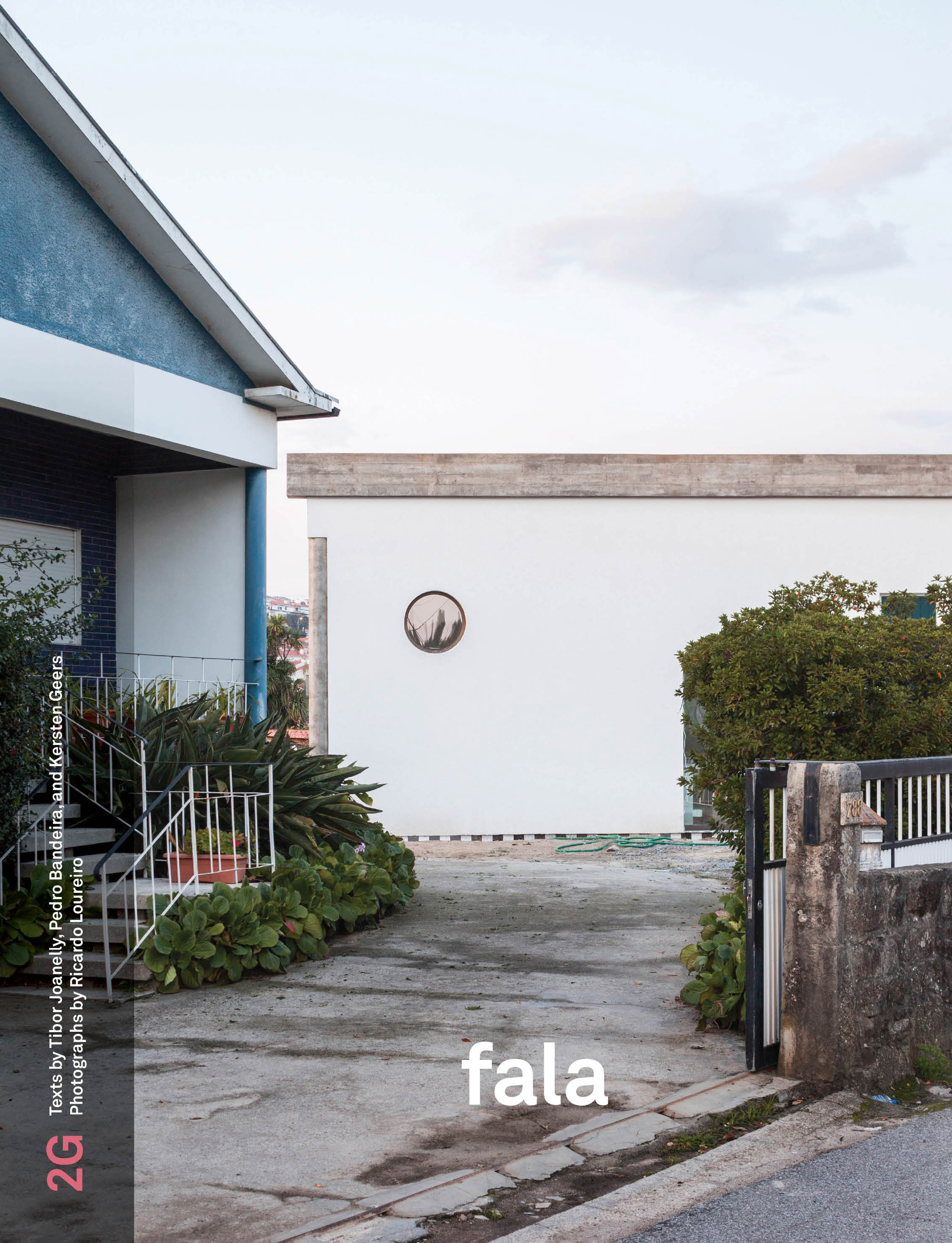
2G

033